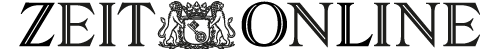Was von den Wahlen in Syrien zu erwarten ist – und was nicht
An diesem Sonntag finden in Syrien Wahlen statt, das klingt erst einmal gut. Zum einen sind Wahlen zumindest ein positives Signal. Ohne sie gibt es keine Bürgerbeteiligung und keine Demokratie. Zum anderen war eine solche Schlagzeile aus Syrien noch bis vergangenen Dezember undenkbar. Diktator Baschar al-Assad überzog das Land mit Gewalt und Bürgerkrieg, liess Tausende Menschen in Foltergefängnissen wegsperren.
Assad wurde im Dezember 2024 gestürzt, floh aus dem Land. Hinter dem Putsch stand die Rebellengruppe Hajat Tahrir al-Scham, kurz HTS. Ihr Anführer, Ahmed al-Scharaa, regiert Syrien seitdem. Und ebenfalls seitdem rätseln Beobachterinnen und Beobachter des Landes, ob das nun gut ist, weniger gut oder schlecht, ob Bangen oder Hoffen angebracht ist. Für beides gibt es gute Gründe.
Auf der Hoffen-Seite steht: Die Assads regieren nicht mehr, das Land hat sich nach mehr als vier Jahrzehnten aus diesem Würgegriff befreit. Die Tore der Foltergefängnisse wurden geöffnet, Familien konnten lange verschollen geglaubte Angehörige wieder in die Arme schliessen. Oder immerhin endlich um die Verstorbenen trauern, von deren Schicksal sie manchmal jahrzehntelang nichts wussten.
Der neue Machthaber Al-Scharaa beteuert regelmässig, einen moderateren Kurs einschlagen zu wollen. Bemüht sich darum, die internationale Isolation aufzulösen, trat kürzlich bei der UN-Vollversammlung auf, schüttelte sogar seinem früheren Erzfeind David Petraeus, dem einstigen Befehlshaber der US-Streitkräfte im Irak, die Hand. In früheren Zeiten standen die beiden sich in blutigen Gefechten während des Irakkriegs gegenüber.
Nun sollte man solche Gesten nicht überbewerten (auch dann nicht, wenn sie wie im Fall Annalena Baerbock demonstrativ ausbleiben).
Aber es gibt auch ein paar messbare Signale. Kürzlich schloss Syrien Investitionsverträge ab, um den Tourismus im Land wiederaufzubauen. Das mag verfrüht klingen, lässt sich aber letztlich auch als Signal an die Bevölkerung verstehen, ihr eine Perspektive aufzeigen zu wollen. Die Sanktionen gegen das Land wurden gelockert. In kleinen Schritten kehren Anzeichen zivilen Lebens zurück in das Land. Laut einer Umfrage des Arab Center Washington DC aus dem Sommer sagten immerhin 56 Prozent der Befragten, das Land bewege sich in die richtige Richtung.
Ist diese Wandlung glaubhaft?
Diesen hoffnungsvollen Anzeichen stehen zahlreiche besorgniserregende Entwicklungen gegenüber. Das HTS ist aus Al-Kaida hervorgegangen. Al-Scharaa hat zwar seinen früheren Kampfnamen Abu Mohammed al-Dschaulani abgelegt, doch viele Syrerinnen und Syrer glauben ihm diese Wandlung hin zum moderaten Reformer nicht so recht. Mehrfach kam es auch nach seiner Machtübernahme in Syrien zu Gewalt, an der HTS-Truppen massgeblich beteiligt waren.
Im März sollen im Westen des Landes mehr als 1'000 Angehörige der alevitischen Minderheit getötet worden sein. Die Regierung sprach von Kämpfen mit ehemaligen Kämpfern des Assad-Regimes (der Ex-Diktator ist selbst Alevit), andere sprachen von gezielten ethnisch motivierten Massakern an Zivilisten.
Im Juli eskalierte ein Konflikt in der Region Suweida im Süden des Landes zwischen Drusen und Beduinen. Die Regierung schickte Truppen, angeblich zum Schutz der Drusen und zur Befriedung des Konflikts. Augenzeugen wiederum berichten auch in diesem Fall eine andere Version: Kämpfer des HTS hätten gezielt drusische Zivilisten getötet. Auch die israelische Armee griff in den Konflikt ein, nur knapp entging die Region einem weiteren Krieg im Nahen Osten.
Solche Meldungen werfen die Frage auf, wie Al-Scharaa und seine Anhänger künftig mit Minderheiten im Land umgehen werden. Al-Scharaa betont zwar immer wieder, er wolle diese schützen. Die gewaltsamen Zwischenfälle lassen daran jedoch begründete Zweifel aufkommen. Unklar ist, ob der syrische Interimspräsident selbst solche Eskalationen vorantreibt, oder ob er seine eigenen Truppen nicht unter Kontrolle hat. Zahlreiche HTS-Kämpfer gehörten früher zu islamistischen Gruppierungen, darunter auch Terrorgruppen wie die Al-Nusra-Front. Nicht unplausibel, dass dort nicht alle den vermeintlich moderaten Kurs des Präsidenten befürworten. Berichten zufolge lasse Al-Scharaa zwar auch innerhalb seiner eigenen Truppen jene verfolgen oder suspendieren, die sich an solchen Massakern beteiligen. Ob darunter tatsächlich ein interner Machtkampf zwischen Al-Scharaa und seinen früheren Verbündeten schwelt, ist jedoch fraglich.
Das gemeine Volk ist aussen vor
Vor diesem Hintergrund sind auch die nun anstehenden Wahlen zu betrachten. Auch hier sind ein paar Lichtblicke zu bemerken, die allerdings nicht von relevanten Defiziten ablenken können. Auf der Haben-Seite: Es entsteht überhaupt ein Parlament, das ein Gegengewicht zur Macht der Regierung und des Präsidenten bilden kann. Auch sollen darin Frauen und Menschen mit Behinderung per Quote vertreten sein. Wahlbeobachter sollen den Prozess begleiten.
Es gibt jedoch auch massgebliche Einschränkungen. Gewählt wird nur das Parlament, Al-Scharaa als Präsident steht nicht zur Disposition. Ob und wie die Bewohner der beiden kurdischen Provinzen Syriens an dieser Wahl beteiligt sein werden, ist unklar. Die Provinz Suweida im Süden ist von der Wahl ausgenommen. Angeblich soll die Abstimmung dort nachgeholt werden, sobald das möglich ist. Bis dahin sollen die entsprechenden Sitze im Parlament vakant bleiben. Wichtige Minderheiten im Land dürften wegen solcher Manöver bis auf Weiteres nicht angemessen im Parlament vertreten sein.
Vor allem aber: Gewählt wird nach einem komplizierten System, das eine direkte Wahl durch das Volk ausschliesst. Al-Scharaa selbst ernennt ein Drittel der Abgeordneten. Und auch auf die Zusammensetzung der anderen zwei Drittel hat er indirekten Einfluss. Der syrische Machthaber hat ein zentrales Wahlkomitee ernannt. Das wiederum ernennt lokale Wahlkomitees, die mit der Zusammensetzung von sogenannten Wahlversammlungen betraut sind. Nur diese Wahlmänner und -frauen können wählen und gewählt werden. Nirgends im Land hängen Wahlplakate. Der grösste Teil der Bevölkerung Syriens bleibt aussen vor und kann weder wählen noch gewählt werden.
Das Land wäre für direkte Wahlen nicht bereit
Der versprochene Wein ist also allenfalls eine dünne Schorle. «Unterm Strich sind sie weder eine gute noch eine schlechte Nachricht», sagt der syrischstämmige Verfassungsrechtler und Nahostexperte Naseef Naeem vom Berliner Beratungsnetzwerk Zenith Council im Telefongespräch mit der ZEIT. Die Legitimation Al-Scharaas bleibe eine De-facto-Legitimation durch die Revolution.
Aber ist das bloss Eigennutz? Vermutlich nicht. In solchen Übergangsphasen ist es nicht unüblich, dass nicht ad hoc vollumfängliche Wahlen stattfinden. «Dafür wäre das Land gerade auch gar nicht bereit», sagt Naeem. Die Infrastruktur ist zerstört, Millionen Syrerinnen und Syrer sind immer noch vertrieben und können also nicht wählen, die Sicherheit ist nicht überall gewährleistet.
Man sollte sich von dieser Wahl nicht zu viel versprechen und darauf gefasst sein, auch in Zukunft noch häufiger ernüchternde Nachrichten aus Syrien zu lesen. Dennoch scheint ein pragmatischer Blick angebracht. Naeem sagt, ihn erinnere manches im heutigen Syrien an Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele in der Bevölkerung wollten damals in erster Linie nicht eine neue Verfassung, sondern vor allem: Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität, Nahrung und eine Perspektive. So gehe es auch vielen Menschen in Syrien. An diesen Bedürfnissen werden sich die syrische Regierung und das künftige Parlament irgendwann messen lassen müssen.
Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.