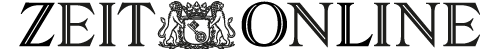Sexskandal in Thailand: Frau Golf, die Mönche und die Gier
Kurz bevor es dunkel wird, glänzt der Ort, an dem einer der schwersten Skandale des thailändischen Buddhismus seinen Ausgang genommen hat. Goldene Turmbauten, goldene Giebel und goldene Türrahmen reflektieren das Abendlicht. Aus einem Fenster des Tempels Wat Tri Thotsathep Worawihan in Bangkok dringt der rhythmische Gebetssingsang der Mönche nach draussen. Jeden Abend kommen sie hier kurz vor Sonnenuntergang zur gemeinsamen Andacht zusammen – eine fest eingespielte Routine in dem traditionsreichen Kloster, dessen Bau einst direkt von Thailands Königshaus veranlasst wurde.
Doch die alten Rituale können nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Tempel sich in einem tiefen Umbruch befindet. Seit wenigen Wochen wissen die betenden Mönche: Ausgerechnet der Mann, der sie bis vor Kurzem anführte, soll gesündigt haben.
In dem Fall, der das religiöse Leben in Thailand schwer erschüttert hat, geht es um Sex, Gier, Lügen und Betrug – und um die Frage, wie die Gläubigen des Landes ihrer religiösen Elite künftig überhaupt noch trauen können. Im Mittelpunkt stehen eine 35 Jahre alte Frau und der Verdacht, dass mehrere ranghohe Mönche eine Intimbeziehung zu ihr unterhielten – damit hätten die Geistlichen ihr Keuschheitsgelübde gebrochen. Ermittlern zufolge sollen sie der Frau, die thailändische Medien vor allem bei ihrem Spitznamen «Sika Golf» nennen, viel Geld überwiesen haben – mutmasslich zumindest teilweise abgezweigt aus Spendengeldern. Umgerechnet etwa zehn Millionen Euro sind auf den Konten der Frau eingegangen, wie der Chef der Antikorruptionseinheit der thailändischen Polizei, Prasong Chalermpan, auf einer Pressekonferenz sagte.
Ein Mönch setzt sich ins Ausland ab
In Thailand, wo mehr als 90 Prozent der Einwohner buddhistisch sind und Mönche als moralische Instanz gelten – verehrt als unantastbare Hüter von Tugend und Disziplin –, stürzen die Vorwürfe den Klerus in eine tiefe Krise. Es ist zwar bei Weitem nicht der erste Skandal in dem Land, bei dem buddhistische Würdenträger für Negativschlagzeilen sorgen. Doch die grosse Zahl an mutmasslich beteiligten prominenten Tempelvertretern hat dem Ansehen religiöser Institutionen einen schweren Schlag versetzt – und eine Debatte über ein System ausgelöst, in dem persönliche Bereicherung und Machtmissbrauch zu florieren scheinen.
Die jüngsten Enthüllungen über das geheime Leben hinter den heiligen Klostermauern begannen Ende Juni mit dem Mann, der im Bangkoker Wat Tri Thotsathep Worawihan damals noch das Sagen hatte. Er nannte sich Phra Thep Wachirapamok und war der erst zehnte Abt in der mehr als 150-jährigen Geschichte des Tempels. Doch von dem ehrwürdigen Amt zog sich der Mitte 50-Jährige vor etwas mehr als einem Monat überraschend zurück. Ohne Angaben von Gründen trat er aus dem Mönchsstand aus. Medienberichten zufolge soll sich der Ex-Geistliche kurz darauf ins benachbarte Laos abgesetzt haben.
Hintergrund waren offenbar Untersuchungen der Polizei. Sie ermittelte zu einem Video, das in Klosterkreisen in Umlauf geraten war und den damaligen Obermönch in einem Hotelzimmer an der Seite einer Frau zeigen soll. Die Beamten vermuteten thailändischen Medien zufolge einen Zusammenhang mit einem anderen Tempelskandal, bei dem es ebenfalls um die mutmassliche Veruntreuung grosser Geldsummen durch einen Abt mit einer weiblichen Komplizin ging. Dazu befragen konnten die Beamten Phra Thep Wachirapamok nach seiner Ausreise aber nicht mehr.
Stattdessen wurden die Polizisten bei der Frau aus dem Video vorstellig – Sika Golf. «Sika» ist in Thailand ein Titel für weibliche Gläubige. Sie durchsuchten ihr Haus, das von lokalen TV-Sendern als Luxusresidenz beschrieben wird, und fanden darin nicht nur mehrere Mönchsroben, sondern auch fünf Mobiltelefone mit umfangreichen mutmasslichen Beweisstücken: Sie enthielten mehr als 80'000 Fotos und 5'000 Videos, auf denen sie laut den Ermittlern unter anderem beim Geschlechtsverkehr mit unterschiedlichen Mönchen zu sehen sein soll. Die Polizisten fanden nach eigenen Angaben auch Hinweise darauf, dass Sika Golf mit den Aufnahmen versucht haben soll, die Männer zu erpressen. Sie wurde deswegen Mitte Juli in Untersuchungshaft genommen – vorgeworfen werden ihr auch Geldwäsche und die Annahme von Diebesgut.
Strafverfahren gegen Mönch eingeleitet
Anhand der Bilder und Chatprotokolle rekonstruierten die Beamten das Beziehungsgeflecht, das Sika Golf über die Jahre eingegangen sein soll. Mindestens 13 Mönche aus zehn verschiedenen Klöstern standen den Ermittlern zufolge mit ihr in Verbindung und legten seither ihre Mönchsroben ab. Die Polizei ermittelt nun, ob sie mit ihren mutmasslichen Überweisungen an die Frau Tempelgelder veruntreut haben.
Gegen mindestens einen Mönch ist diesbezüglich bereits ein strafrechtliches Verfahren eröffnet worden: Der frühere Abt eines Tempels in der alten Königsstadt Ayutthaya gestand, Geld von dem Klosterkonto an Sika Golf überwiesen zu haben – eine gemessen an der Gesamtdimension des Falls vergleichsweise kleine Summe von umgerechnet rund 10'000 Euro. Zuvor hatte der 67 Jahre alte Abt der Frau eigenen Angaben zufolge mehr als 320'000 Euro aus seinem Privatvermögen bereitgestellt – angeblich als Kredit. Ein Verhältnis mit Sika Golf habe er jedoch nicht gehabt, teilte der Ex-Abt mit. Dies bestätigte Medienberichten zufolge Sika Golf.
In einem TV-Interview, das am Tag ihrer Verhaftung ausgestrahlt wurde, gab sie an, intime Beziehungen zu Mönchen gehabt zu haben. Begonnen hätten diese im Jahr 2013: Über eine Chat-App sei sie in Kontakt zu einem Abt in ihrer Heimatprovinz Phichit im Norden Thailands gekommen. Aus den Chats sei eine Affäre geworden. Der Abt habe sie grosszügig beschenkt – unter anderem mit einem Mercedes-Benz SLK 200. In den Jahren darauf habe sie sich weiteren ranghohen Mönchen angenähert. In dem Interview sprach sie von Sex mit den Geistlichen in Autos, Privathäusern und Mönchszellen im Kloster. Anfangs habe sie sich deshalb schuldig gefühlt – allein die blosse Berührung eines Mönchs durch eine Frau ist in Thailand tabu. Doch an den finanziellen Zuwendungen habe sie auch Gefallen gefunden: Es sei ihr darum gegangen, genug Geld zu haben, um für sich und ihre Kinder ein gutes Leben zu garantieren, sagte sie.
Auch vom Abt des Bangkoker Wat Tri Thotsathep Worawihan forderte Sika Golf den Ermittlern zufolge Geld – umgerechnet etwa 200'000 Euro als Unterhalt für ein angeblich gemeinsam gezeugtes Kind. Der Tempelvorsteher soll sich jedoch geweigert haben zu bezahlen, wonach Sika Golf Videomaterial mit ihm in Umlauf gebracht haben soll – der Grund, weshalb der Skandal öffentlich wurde. Die Frau sagte später im Interview, dass das Kind nie zur Welt gekommen sei – sie habe eine Fehlgeburt erlitten.
Was von den Angaben wahr ist und wo es sich womöglich nur um Schutzbehauptungen handelt, wird Gegenstand des Prozesses sein, dem sich die Mutter von drei Kindern nun wohl stellen muss. Mehrere Fragen zu ihrem Vorgehen sind noch offen – zum Beispiel auch, was genau mit den Millionensummen geschah, die sie über mehrere Jahre erhalten haben soll. Bei ihrer Festnahme hatte Sika Golf Medienberichten zufolge nur noch etwas mehr als 200 Euro auf dem Konto. Ermittlern zufolge gab sie erhebliche Summen für illegales Onlineglücksspiel aus.
Breit diskutiert wird auch die Frage, bei wem der Grossteil der moralischen Verantwortung in dem Fall liegt. Thailändische Medien konzentrierten sich anfangs auf Sika Golf und gaben ihr Beinamen wie «Mönchskillerin» und «Verführerin». Die in den Skandal verwickelten Mönche wurden in erster Linie als naive Opfer beschrieben. Politiker im thailändischen Oberhaus sprachen sich sogar für eine Gesetzesverschärfung aus, die eine strafrechtliche Verfolgung von Frauen vorsieht, wenn diese Sex mit Mönchen haben.
Doch gegen diese Sicht auf den Skandal regt sich auch Widerstand: Die Schlagzeilen über den Fall zeigten eine «tief verwurzelte Frauenfeindlichkeit im thailändischen Buddhismus», klagt die Kolumnistin und Religionsexpertin Sanitsuda Ekachai in einem viel beachteten Meinungsbeitrag zu dem Fall. Frauen würden in den gängigen Lehren seit Langem als Feindinnen der spirituellen Reinheit der Mönche dargestellt. Auch in der aktuellen Affäre werde die Schuld auf den Frauen abgeladen – dabei seien es doch die Mönche selbst, die wissentlich Sünden begingen, während sie sich als moralisch überlegen darstellten. «Das ist nicht nur Heuchelei, sondern Betrug», schreibt Sanitsuda.
Kritiker sehen strukturelle Probleme in Thailands Buddhismus
Zudem kritisiert sie, dass sich der Buddhismus in Thailand zu einem geschlossenen System ohne externe Kontrolle entwickelt habe, was Korruption fördere. Äbte hätten die vollständige Kontrolle über das Tempelvermögen und müssten so gut wie keine Rechenschaft ablegen. Gleichzeitig hätten sie umfangreiche Möglichkeiten, sich persönlich zu bereichern – so erhielten bekannte Mönche von Gläubigen hohe Summen, wenn sie bei Zeremonien erschienen. Religiöse Autoritäten unternähmen zu wenig gegen die Gier im Klerus. Es handele sich um ein «System, das sich weit vom Pfad Buddhas entfernt hat».
Tatsächlich spricht die Vielzahl der Skandale, mit denen Thailands Klöster in den vergangenen Jahren konfrontiert waren, für erhebliche strukturelle Probleme. Der Abt einer umstrittenen Sekte wird seit Jahren erfolglos wegen Geldwäscheverdachts gesucht. Dem Chef eines Tempels in der Provinz Nakhon Pathom wurde in diesem Jahr vorgeworfen, knapp acht Millionen Euro aus der Klosterkasse entwendet zu haben. Und in der Provinz Nakhon Nayok wurde während der Coronapandemie ein Fall bekannt, bei dem ein ranghoher Mönch knapp drei Millionen Euro veruntreut haben soll. Immer wieder geraten Mönche auch wegen eines ausschweifenden Lebensstils in die Kritik – bekanntestes Beispiel ist ein Ex-Geistlicher, der von den Medien den Beinamen «Jetset-Mönch» verpasst bekam: Er zeigte sich in Videos in Privatflugzeugen mit Bündeln voller Bargeld – 2018 wurde er unter anderem wegen Betrugs und Geldwäsche zu einer langen Haftstrafe verurteilt.
Auch der aktuelle Skandal zieht Konsequenzen nach sich: König Maha Vajiralongkorn ordnete an, 81 königliche Ernennungen und religiöse Titel, die zuvor insgesamt 81 Mönchen verliehen worden waren, wieder zurückzunehmen. Der Monarch begründete dies mit den Berichten über unangemessenes Verhalten von Mönchen und Religionsvertretern, das bei Gläubigen erhebliche emotionale und spirituelle Belastungen verursacht habe.
Tatsächlich berichten thailändische Buddhisten von einem tiefgreifenden, spirituellen Schock. In einer Umfrage des Nationalen Instituts für Entwicklungsverwaltung (Nida) gaben 58 Prozent der etwa 1'300 Befragten nach Bekanntwerden des Skandals an, dass ihr Glaube an die Mönche gesunken sei. Fast ein Drittel sagte, ihr Glaube an den Buddhismus insgesamt sei zurückgegangen. Fast die Hälfte der Befragten stimmte der Aussage zu, dass manche Mönche von Rang und Reichtum besessen seien.
«Das Ansehen des Mönchsordens hat infolge der Skandale definitiv gelitten», sagt Prakirati Satasut, Buddhismusexperte an der soziologischen und anthropologischen Fakultät der Bangkoker Thammasat-Universität. Mönche erzählten ihm, dass sie inzwischen an öffentlichen Orten unangenehmen Blicken ausgesetzt seien. «Ob das langfristig anhält, wird sich noch zeigen», sagt er. Den Trend, dass das Vertrauen in buddhistische Institutionen abnehme, beobachte er bereits seit Jahren. Nötige Reformen, die das ändern könnten, seien aber nur schwer umsetzbar, glaubt Prakirati. Der Mönchsorden sei ein streng hierarchisches System, in dem junge Mönche von der Gunst der älteren abhängig seien. «Es gibt daher so gut wie keine interne Kritik, wenn Fehlverhalten auffällt.» Eine Chance auf eine Veränderung der Strukturen sieht er nur durch einen Generationswechsel an der Spitze. «Wenn so viele führende Mönche in einen Skandal verwickelt sind, ist es schwer, den verbliebenen Obermönchen zu vertrauen, einen echten Wandel herbeizuführen.»
Auch die Zeitung Bangkok Post stellt in einem Leitartikel fest, dass Reformen wohl kaum von den Mönchen oder vom Staat ausgehen würden – sie profitierten vom Status quo. Wirklicher Wandel sei deshalb nur möglich, wenn die Gläubigen aufhörten, ein kaputtes System mit ihren Spenden zu füttern. «Wenn sich der Klerus nicht ändert, müssen es die Gläubigen tun», fordert die Zeitung. Den Geldbeutel nicht bei jeder Gelegenheit blind zu zücken, sei ein erster Schritt.
Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.