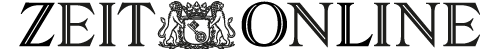«Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern»
Herr Risse, wie würden Sie den Zustand der Demokratie in den USA im Herbst 2025 in einem Satz beschreiben?
Mathias Risse: Er ist sehr ernst, ich mache mir grosse Sorgen um den Fortbestand der amerikanischen Demokratie.
Was sorgt Sie besonders?
Dass Präsident Donald Trump und seine Republikanische Partei eine Sicherheitskrise nach der anderen herbeireden. Dass sie zum Beispiel behaupten, in Städten wie Portland oder Chicago herrsche ein nationaler Notstand, der nur mit dem Einmarsch der Nationalgarde zu beheben sei. Jetzt hat Trump sogar gefordert, US-Grossstädte zu Übungsplätzen fürs Militär zu machen. Es sorgt mich ebenso, dass Trump und die Republikanische Partei alles tun, um ihre politische Macht möglichst dauerhaft zu zementieren. So ziehen die Republikaner derzeit in vielen Bundesstaaten die Wahlkreise zu ihrem Vorteil neu, und fast alle in der Partei sind einem Persönlichkeitskult anheimgefallen. Trump-kritische Republikaner werden aktiv herausgedrängt oder werfen aus Frustration selbst das Handtuch.
Welche demokratischen Institutionen sind aus Ihrer Sicht besonders gefährdet?
Zum Beispiel die Institution der Präsidentschaft. Wir können nicht mehr sicher sein, dass Trump im Januar 2029, nach zwei Amtsperioden, das Weisse Haus räumen und es einen verfassungsgemässen Machtwechsel geben wird. Am schlimmsten aber steht es um unsere Volksvertretung, den Kongress. Die Republikaner haben in beiden Häusern, also im Repräsentantenhaus und im Senat, die Mehrheit. Sie sind aber keine Kontrolleure der Exekutive, also auch des Präsidenten, sondern sind sein willfähriges Instrument.
Aber die Demokratische Partei ist ebenfalls eine Institution, bis vor Kurzem war sie sogar an der Regierung. Wo ist ihr Widerstand?
Das frage ich mich manchmal auch. Die Demokraten haben derzeit weder besonders sichtbare noch eindrucksvolle Führungsfiguren. Die Partei ist in weiten Teilen unglaublich passiv, mal abgesehen davon, dass sie als Opposition und Minderheit im Machtgefüge keine besonders starke Rolle hat. Immerhin hat sie jetzt im Senat Trumps Übergangshaushalt blockiert, mit der Folge eines landesweiten Shutdowns, was heisst, dass viele Leistungen der Bundesverwaltung derzeit stillstehen.
Haben wir die Resilienz der US-Demokratie überschätzt?
Das muss sich zeigen. Ich bin da auf längere Sicht nicht ganz so pessimistisch. Das föderale System der USA hat tiefe Wurzeln, die Macht der einzelnen Bundesstaaten ist gross und zeigt sich zum Beispiel am Widerstand von Staaten wie Kalifornien oder Illinois. Es ist darum gut möglich, dass demnächst die Menschen in den verschiedenen Bundesstaaten noch weit eigenständiger leben werden, als das ohnehin schon der Fall ist. Ausserdem haben viele US-Amerikanerinnen und -Amerikaner nach wie vor ein sehr ausgeprägtes staatsbürgerliches Bewusstsein, und auch die Philanthropie hat grossen Einfluss auf das politische Geschehen. Und es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen Trumps Wirtschaftspolitik auf unser Leben und damit auch auf die Politik haben wird.
Heisst das, nur leere Geldbörsen können einen Meinungsumschwung herbeiführen und Trump stoppen?
Ja, so traurig das auch ist. Die Ausdehnung der Regierungsmacht ruft bislang leider wenig Widerstand hervor, und viele Eliten kriechen zu Kreuze, solange die Kasse stimmt. Trump fürchtet, dass sich das ändern könnte, sobald die Wirtschaft nachhaltig schwächelt. Deshalb übt er enormen Druck auf die Notenbank aus, will partout die Zinsen senken, damit die Folgen der Zölle und der erratischen Wirtschaftspolitik die Menschen nicht so hart treffen.
Trump, als Herr der Exekutive, dominiert bereits den Kongress, zunehmend auch die Justiz, vor allem das oberste Gericht, den Supreme Court, und auch den unabhängigen Medien geht er an den Kragen. Ist darum die Wirtschaft das grösste Risiko für ihn, die grösste Hürde für die Regierung?
Ja, um die Gewaltenteilung steht es in der Tat nicht gut. Die konservative Mehrheit im Supreme Court hat Trumps Machtfülle genehmigt und die Rechtsauffassung bestätigt, dass ein Präsident für sein Verhalten im Amt so gut wie nie zur Rechenschaft gezogen werden kann.
Wie politisiert ist der Supreme Court – und welche Folgen hat das für die Legitimität der Justiz?
Ich würde hier nicht von Politisierung sprechen, denn das klingt so, als würde das oberste Gericht unjuristisch entscheiden und etwas tun, was es nicht darf. Die konservative Mehrheit des Supreme Court wird aber von rechtlichen Argumenten geleitet, die voll auf der Linie des Präsidenten liegen.
Sie meinen damit die «theory of the unitary executive power», der zufolge ein Präsident fast uneingeschränkte exekutive Macht besitzt. Hat diese Rechtsmeinung Tradition?
Nein, dieses Verständnis ist erst allmählich in Reaktion auf den Aufbau der öffentlichen Verwaltung entstanden, zunächst nach dem Bürgerkrieg, aber dann besonders im vergangenen Jahrhundert mit den neuen grossen Wohlfahrtsprogrammen. Es herrschte bislang die Auffassung, dass Behörden im Rahmen ihrer Aufgaben einigermassen selbstständig handeln dürfen, und alle Präsidenten haben das im Grossen und Ganzen auch so akzeptiert. Seit Trump aber setzt sich nicht nur in der Regierung, sondern auch in der konservativen Mehrheit am Supreme Court die Meinung durch, dass ein US-Präsident als Staatsoberhaupt einen fast uneingeschränkten Durchgriff auf die gesamte Exekutive geniesst. Doch die grösste Gefahr für die Legitimität der Justiz geht von der politischen Instrumentalisierung des Justizministeriums aus. Trump erteilt diesem direkte Anweisungen und unterwirft es seinen Prioritäten und persönlichen Rachefeldzügen gegen politische Gegner.
Gleichwohl sind es vor allem Gerichte, die sich Trump immer wieder in den Weg stellen. Sind sie eines der letzten Bollwerke?
Widerstand leisten die unteren Gerichte, einige Bundesgerichte, aber nicht das oberste Gericht. Der Supreme Court hat Trump neulich erst wieder erlaubt, dass er im Haushalt eigenmächtig vier Milliarden Dollar Entwicklungshilfe streichen und das Geld auch wieder herausnehmen darf, obwohl der Kongress dieses Budget längst beschlossen hat.
Zielscheibe sind auch die liberalen Universitäten, vor allem auf Ihre Uni Harvard hat Trump es abgesehen. Er begründet seine Massnahmen gegen diese Hochschulen damit, dass er lediglich das politische Gleichgewicht wiederherstellen wolle. In seinen Augen hat die Linke diese Balance mit «Cancel-Culture», «Wokeness-Bewegung» und einem an den Hochschulen grassierenden Antisemitismus empfindlich gestört. Hat Trump damit nicht einen Punkt?
Es gab in der Tat einige hässliche Vorkommnisse an einigen Universitäten, gerade auch nach dem Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober 2023. Da ist einiges schiefgelaufen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Trump-Regierung diese Exzesse gezielt übertreibt und als Vorwand benutzt, um die Unis und die Vereinigten Staaten kulturell und ideologisch zu verändern. Stellen Sie sich einmal vor, in Deutschland würde der Kanzler sich mit ein paar Ministern zusammensetzen und beim Cocktail aushecken, wie man einige ihnen politisch missliebige Universitäten aushebeln kann.
Woher rührt dieser erbitterte ideologische Kampf?
Dafür muss man in die Entstehungsgeschichte der Vereinigten Staaten zurückgehen. Die Einwanderer aus Europa kamen mit hehren Idealen in die Neue Welt, aber die Eroberung Nordamerikas und die Umsetzung dieser Ideale gingen einher mit gewaltigen Grausamkeiten. Sie brachten der indigenen Bevölkerung hauptsächlich Tod und Zerstörung. Und über Jahrhunderte wurden aus Afrika entführte Menschen als Sklaven eingesetzt. Es muss uns klar sein, dass eine solche Geschichte tiefe Spuren hinterlässt, grosse Traumata auf der einen, ein überhöhtes Selbstwertgefühl auf der anderen Seite. Die Linken fordern, sich dieser Vergangenheit zu stellen und sich mit deren langem Schatten ehrlich zu befassen. Es empört sie, dass dies noch nicht umfassend geschehen ist. Die Rechten hingegen empören sich gerade über diese Forderung und möchten den Status quo der immer noch mehrheitlich weissen Bevölkerung, den die Linke als «privilegierten Status» geisselt, nicht in einem historischen Kontext verstanden wissen. Es ist richtig, die Cancel-Culture kam aus der linken Ecke, dort wollte man sehr schnell sehr viel ändern und hat dabei übertrieben. Doch die Reaktion der Rechten und der Trump-Regierung darauf ist absolut masslos.
Wie weit ist die Republikanische Partei noch eine klassische Partei?
Wir erleben eine Partei, die einem Persönlichkeitskult verfallen ist und von einer grossen Lüge angetrieben wird, von der angeblich gefälschten Präsidentschaftswahl 2020, bei der Trump unterlag. Jeder Republikaner, der heute gewählt werden will, muss einen Rütlischwur auf Trump leisten. Wer nicht voll auf Linie ist, bekommt in den Vorwahlen sofort einen gut finanzierten Gegenkandidaten vor die Nase gesetzt. Klassische Parteien, jedenfalls wie Deutsche sie verstehen, gibt es in den USA nicht. Hier sind die zwei grossen Parteien eher allgemeine Wahlvereine, ohne grosse innere Strukturen und programmatische Kraft. Das Regierungsprogramm für Trump hat die Heritage Foundation, ein inzwischen ultrarechter Thinktank, geschrieben. Trump selbst ist kein wirklicher Ideologe, und er ist nur zufällig Republikaner, er brauchte eine Partei, um Präsident zu werden. Weit wichtiger für ihn ist seine MAGA-Bewegung, die die Republikanische Partei längst in Geiselhaft genommen hat.
Welche Verantwortung trägt die Demokratische Partei an dieser Entwicklung?
Auch sie hat zur Misere beigetragen, indem sie zum Beispiel die Belange der Arbeiterschaft völlig aus den Augen verloren hat. Aber man darf nicht übersehen: Trumps Leugnung seiner Wahlniederlage 2020 und der von ihm angeheizte Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 sind zum politischen Kristallisationspunkt dieses Jahrzehnts geworden. Das hat schwerwiegende Folgen, denn mit dieser Lüge sprechen die Republikaner Präsident Joe Biden und seinen Demokraten jede Form von Legitimität ab. Und diese Lüge nutzen sie auch zur Rechtfertigung ihrer Politik, die so gut wie alles hinwegfegt, was die Regierung Biden beschlossen hat. Für Trump sind die Demokraten kein politischer Gegner, sondern eine Verbrecherbande, die man bekämpfen muss.
Sie nennen das, was derzeit in den USA passiert, «rachsüchtige Toleranz» – in Anlehnung an Herbert Marcuses Begriff von der «repressiven Toleranz». Was meinen Sie damit?
Marcuse verstand unter «repressiver Toleranz» eine Duldsamkeit, die bestimmte Meinungen zwar zulässt, aber nur, weil sie im gegenwärtigen politischen System sowieso keine Chance auf Realisierung haben. Parallel dazu habe ich jetzt den Begriff der «rachsüchtigen Toleranz» formuliert. Das heisst: Die Herrschenden preisen ihre Gesellschaft als tolerant an und sehen sich selbst als Bewahrer dieser Toleranz.
Und was folgt daraus?
Statt den politischen Gegner innerhalb des Systems inhaltlich anzugehen und seine Positionen infrage zu stellen, werden die politischen Konkurrenten als Gegner der toleranten Gesellschaft bezichtigt. Sie werden damit nicht zu Gegnern im System, sondern zu Gegnern des Systems. Die Folge: Sie werden frontal als Systemfeinde angegriffen, moralisch abgekanzelt und mit rechtlichen Mitteln verfolgt. Das charakterisiert derzeit unsere Lage.
Können Sie das konkreter machen?
Wer seit der Ermordung des rechten Aktivisten Charlie Kirk dessen politische Positionen kritisiert und sich für eine Stärkung der Bürger- und Minderheitenrechte einsetzt, ist für Trump und seine Entourage sofort ein zur Gewalt anstiftender Aufwiegler. Die Regierung prüft sogar, ob sie gegen diese Kritiker Strafrechtsparagrafen anwenden kann, deren Zweck eigentlich die Bekämpfung organisierter Verbrechen ist. Mehr noch: Die Trump-Regierung verhängt international Sanktionen gegen Menschen wie etwa den brasilianischen Richter Alexandre de Moraes und dessen Frau. Moraes hat dafür gesorgt, dass der ehemalige brasilianische Präsident Bolsonaro wegen eines Putschversuchs nach verlorener Wahl zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Die Ironie dieses Vorgangs: Die US-Sanktionen gegen Moraes fussen auf einem Gesetz, das eingeführt wurde, um brutale Menschenrechtsverletzungen zu ahnden – und nicht, um das exakte Gegenteil, die Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten, zu bestrafen. So tief sind wir gesunken.
Wie würden Sie Trumps Strategie definieren?
Mit zwei Begriffen, die meiner Meinung nach essenziell sind, um zu begreifen, was hierzulande geschieht: Das ist zum einen das sogenannte Gaslighting, ein Führungsstil, der dem politischen Gegner pausenlos unterstellt, er wäre derjenige, der grundlegende Normen und Werte der Gesellschaft verletze. Trump und sein Vize Vance sind Meister darin und verschaffen sich damit Freiräume für ihre Hasstiraden. Und zum anderen ist da die vindictive tolerance, die rachsüchtige Toleranz, die ich bereits beschrieben habe.
Einige ziehen bereits Parallelen zum aufkommenden Faschismus im Deutschland der 1920er- und 1930er-Jahre. Taugt dieser Vergleich?
Ich wäre mit solchen Vergleichen eher vorsichtig. Natürlich gibt es gewisse Ähnlichkeiten, aber eben auch deutliche Unterschiede. Trump ist gerade mal knapp neun Monate im Amt, in dieser Zeit hatten damals die Nazis Deutschland schon unter ihre totale Kontrolle gebracht und gingen weit brutaler und rücksichtsloser vor.
Wie gross ist die reale Gefahr politischer Gewalt, etwa durch Milizen, Attentate oder einen «schleichenden Bürgerkrieg»?
Diese Gewalt gibt es ja bereits. Die Ermordung Charlie Kirks ist das wohl bedeutendste politische Attentat seit den 1960er-Jahren, in denen unter anderem Präsident John F. Kennedy, sein Bruder Robert Kennedy und der Bürgerrechtler Martin Luther King ermordet wurden. So furchtbar das Attentat auf Kirk auch ist, insgesamt verzeichnen wir hierzulande mehr Gewalttaten durch die extreme Rechte als durch die extreme Linke. Es sind die Rechten, die sich in Milizen wie den Proud Boys zusammenrotten. Und die Gefahr einer sich beschleunigenden Gewaltspirale ist äusserst real, zumal Präsident Trump nicht zur Mässigung und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt aufruft, sondern das Feuer schürt.
Viele Bürger beruhigen sich nach dem Motto: «So schlimm wird es schon nicht kommen.» Wie trügerisch ist dieses Gefühl?
Äusserst trügerisch, vor allem wenn man sieht, was die Trump-Regierung schon alles grundstürzend verändert hat. Zwar haben die No-Kings-Demonstrationen, die Millionen Menschen auf die Strasse brachten, gezeigt, dass viele US-Amerikanerinnen und -Amerikaner den Ernst der Lage durchaus begreifen. Aber die Frage bleibt, ob sich diese Art von Mobilmachung aufrechterhalten lässt – vor allem jetzt, da die Regierung nach der Ermordung Kirks mit aller Kraft versucht, oppositionelle, liberale und linke Gruppen mit dem organisierten Verbrechen gleichzusetzen.
Welche gesellschaftlichen Kräfte leisten tatsächlich Widerstand – Kirchen, Medien, Universitäten, zivilgesellschaftliche Gruppen?
Es erstaunt mich, wie wenig Widerstand bislang aus dem kirchlichen Raum gekommen ist. Etliche dort scheinen sich mit vielem, was Trump tut, arrangieren zu können, zumal sie ja von der Regierung als Gegenleistung eine starke Unterstützung der Religiosität bekommen. Die überproportionale Präsenz von Katholiken im Kabinett ist ein bemerkenswertes Phänomen. Auch die Medien liefern ein gemischtes Bild. Zum Glück gibt es immer noch viele, für die Unabhängigkeit kein blosses Lippenbekenntnis ist. Doch zeigt die kurzzeitige Absetzung der Jimmy-Kimmel-Show, wie stark der Druck auf die Medienkonzerne ist. Und was die Universitäten anbelangt, so ist Harvard bislang die einzige, die sich gegen die Erpressungsversuche der Trump-Regierung juristisch gewehrt hat. Rund 20 weitere Unis haben Harvards Gang zum Gericht mit einem sogenannten Amicus-Curiae-Brief unterstützt. Aber angesichts des brachialen Angriffs auf die Wissenschafts- und Meinungsfreiheit hätten eigentlich mindestens 400 Hochschulen Harvard beispringen müssen. Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern, allen voran einige der grössten Anwaltskanzleien. Mut ist in solchen Zeiten offenbar eine rare Tugend. Die Stolpersteine in deutschen Städten, die an die Opfer der Nazizeit erinnern, dienen da als stete Mahnung.
Wo verlaufen die roten Linien, deren Überschreitung das demokratische System in den Abgrund stossen könnte?
Eine rote Linie würde zum Beispiel verletzt, sollte die Regierung in ganz eklatanter Weise Gerichtsurteile missachten oder sollte Trump tatsächlich eine dritte Amtszeit anstreben. Aber auch ohne einen Stoss in den Abgrund kann Trump unsere Demokratie und unser Gesellschaftssystem ganz grundlegend verändern, indem er die USA in einen christlich-konservativen Staat verwandelt, mit starker Dominanz der weissen Bevölkerung, verwaltet und beherrscht mit der Unterstützung grosser Polizeikräfte, vielleicht sogar des Militärs. Gaslighting und rachsüchtige Toleranz sind die systematischen Methoden und Hilfsmittel auf diesem Weg. Und dieser Weg wird bereits kräftig beschritten.
Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.