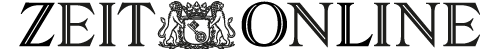«Verrat an Millionen von Amerikanern» – bei den Demokraten fliegen die Fetzen
Man möchte diesen Text über den Zustand der Demokraten gut ein Jahr nach dem Wahlsieg von Donald Trump mit einem tiefen Seufzen beginnen. Nur: Wie schreibt man ein tiefes Seufzen?
*Seufz*?
Man möchte so beginnen, weil dieser Text einen so schönen anderen Einstieg hätte haben können, einen, der Hoffnung macht: Hoffnung darauf, dass Donald Trump doch nicht unbesiegbar ist. Man hätte, zum Beispiel, am Dienstag, dem 4. November beginnen können, mit einer Szene von einer Wahlparty in Richmond im Bundesstaat Virginia, wo es den Sprecher des dortigen Parlaments kaum hinter dem Rednerpult hielt, als er der Menge zurief: «Democrats, we are baaack!» Denn in Virginia, New York, New Jersey und Kalifornien haben die Demokraten am 4. November Wahlen gewonnen, teils haushoch.
Ein «Verrat an Millionen von Amerikanern»
Die Partei hat es allerdings geschafft (hätte, hätte, Fahrradkette), nicht einmal eine Woche nach diesem siegestrunkenen 4. November 2025 schon wieder wie jene orientierungslose Truppe auszusehen, als die sie einen Grossteil des ersten Jahres nach der Wahl von Trump durch Amerika spukte.
Und das kam so: Die Vereinigten Staaten befinden sich, Stand 11. November, im längsten Shutdown der Geschichte. Die Demokraten verweigerten Ende September ihre Zustimmung zu einem neuen Haushalt, und so ist die Regierung seither zahlungsunfähig.
Für viele Amerikaner ist das schmerzhaft. Gehälter im öffentlichen Dienst werden nicht mehr ausgezahlt, die Ärmsten hätten womöglich bald keine Lebensmittelhilfen mehr erhalten. Für die Demokraten allerdings, die in beiden Parlamentskammern in der Minderheit sind, ist die Zustimmung zum Haushalt auch das letzte Machtmittel, das ihnen bleibt. Sie versuchten, damit Kompromisse bei den Krankenkassenzuschüssen zu erringen, die die Republikaner drastisch kürzen, was Millionen Familien Tausende Dollar im Jahr kosten wird.
Die Wähler schienen diesen Einsatz zu schätzen, trotz der Unbill des Shutdowns, und schenkten den Demokraten am 4. November einen gigantischen Wahlsieg, zum Beispiel in Virginia. Am 9. November allerdings scherten acht demokratische Senatoren aus und stimmten einem Vorschlag zu, den Shutdown zu beenden – ohne den Republikanern auch nur eine einzige Konzession abgerungen zu haben.
Andere Demokraten reagierten wütend. Von einem «Fehler» sprach der Senator Chris Murphy. Von «Verrat an Millionen von Amerikanern» der Abgeordnete Greg Casar aus Texas.
Um zu verstehen, wie es der Partei wirklich geht und warum in all dem trotzdem Hoffnung steckt, muss man rauszoomen und zurückschauen. In jenen Sommer, der zwischen Donald Trumps Amtsantritt im Januar und diesen turbulenten Novemberwochen liegt.
Trump wird immer unbeliebter, nur die Demokraten schneiden noch schlechter ab
Eine Turnhalle in der Gemeinde Lenore, tief im Westen von West Virginia, der 9. August. Wie eine missmutige Krähe im Herbststurm sieht der dünne Mann aus, der sich unter Basketballkörben und einer US-Flagge vor ein paar Hundert Menschen aufbaut: Bernie Sanders, 84 Jahre alt, Senator, linke Kultfigur. Als Sohn polnischer Einwanderer wisse er, donnert er, was es bedeute, «von einem Gehaltsscheck zum nächsten zu leben». Deshalb sei der Big Beautiful Bill Act, das Monstergesetz, mit dem die Regierung Trump alle möglichen Sozialleistungen kürzt, «das gefährlichste Gesetz, das jemals erlassen wurde». Jubel und Applaus.
Lenore liegt in einer früheren Kohleregion, einstiges Demokratenland. Hier verschanzten sich in den 1920er-Jahren Bergarbeiter mit Maschinengewehren in den Hügeln, um für bessere Löhne und ein würdiges Leben zu kämpfen. Heute ist West Virginia Trumpland. In dem Wahlkreis um Lenore holte er 2024 bei den Präsidentschaftswahlen 86,3 Prozent der Stimmen. Sanders Reise ins tiefste amerikanische Hinterland ist als Symbol gedacht: Die Demokraten wollen zurück zu den Wurzeln.
Die Demokraten hoffen in jenen Sommerwochen darauf, Donald Trump werde sich selbst demontieren. Durch die Big Beautiful Bill, die die Republikaner vor der Sommerpause verabschiedet haben, werden Millionen Amerikaner ihre Krankenversicherung und ihre Lebensmittelhilfen verlieren, sagen Experten. Ein schreckliches Gesetz, sagen demokratische Parteistrategen. Zynisch betrachtet allerdings: ein politisches Geschenk.
Zunächst aber will sich die Wende nicht einstellen. Im Sommer und Herbst zeigen die Umfragen zwar, wie Donald Trump immer unbeliebter wird. Aber auch, dass die Wähler eines noch schlimmer finden als den Präsidenten: die Demokraten.
Die Marke «Demokraten» sei kaputt, sagen parteinahe Strategen in Washington, D. C. ziemlich offen. Herumgereicht wird eine Studie des Center for Working-Class Politics, einer linken Denkfabrik, für die Wissenschaftler Wählern die Profile fiktiver Kandidaten vorgelegt haben. Die politischen Versprechen dieser fiktiven Kandidaten sind identisch. Aber wenn sie als Demokraten antreten statt als Parteilose, schneiden sie deutlich schlechter ab. Es ist wie verhext: Die Wähler finden gut, was die Demokraten wollen. Der Partei aber vertrauen sie nicht, im Gegenteil. Die Marke wird zum Nachteil für die, die unter ihr antreten.
Zitiert wird in Washington auch eine nicht ganz so repräsentative Studie, bei der Teilnehmer gefragt wurden, mit welchen Tieren sie Demokraten und Republikaner vergleichen würden. Bei den Republikanern wurden Löwen, Tiger und Haie genannt. Bei den Demokraten am häufigsten: das Faultier. Eine befragte Frau soll gesagt haben, die Partei erinnere sie an ein Reh, das im Scheinwerferlicht eines Autos erstarrt sei.
Und so unterzeichnet Trump monatelang ein Dekret nach dem nächsten, lässt Ministerien ebenso abreissen wie den Ostflügel des Weissen Hauses, auf brutale Weise Migranten deportieren und politische Feinde verfolgen. Die Demokraten werden derweil im Umfragekeller depressiv. Bis zum 4. November.
Überraschend stark gewinnen an diesem Tag mit Abigail Spanberger und Mikie Sherrill zwei Demokratinnen die Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey. In New York setzt sich der junge Zohran Mamdani durch. In Kalifornien gewinnen die Demokraten eine wichtige Abstimmung über den Neuzuschnitt von Wahlkreisen. Und auch in weniger beachteten Wahlen siegen sie: bei Verfassungsrichterwahlen in Pennsylvania und der Besetzung von Schulbeiräten an vielen anderen Orten im Land.
Zohran Mamdani sagt Trump den Kampf an:
«Trumps Momentum ist gebrochen»
Neera Tanden, eine Vertraute von Joe Biden, ruft ein paar Tage nach den Wahlen aus dem Auto an. Seit ihrem Ausscheiden aus dem Weissen Haus leitet sie eine der wichtigsten liberalen Denkfabriken des Landes, das Center for American Progress. Tanden ist für ihre kühle Rationalität bekannt, aber auch sie sagt: «Sein Momentum ist gebrochen.» Er, das ist Donald Trump.
Sie zählt auf, warum diese Wahlen ihr Hoffnung machen: 2024 konnte Trump viele Latinos für sich gewinnen, eine traditionelle Wählergruppe der Demokraten. Ein Jahr später wählten Latinos nun wieder «blauer», also demokratischer, in Virginia und New Jersey ebenso wie in New York. Dasselbe gilt für junge Männer und schwarze Männer. Abigail Spanberger konnte in Virginia ausserdem in ländlichen Regionen Wähler zurückgewinnen, die 2024 für Trump gestimmt hatten, vor allem dort, wo Landwirte unter den Zöllen der Trump-Regierung leiden.
Selbst der ein oder andere Republikaner wagt, es auszusprechen: «Wenn ihr nicht versteht, was letzte Nacht wirklich passiert ist, lebt ihr in einer Höhle», warnte Jim Justice, Senator aus West Virginia, seine Parteifreunde nach der Wahl.
Dieser blaue Dienstag ist den Demokraten aber nicht in den Schoss gefallen. So deprimierend der Sommer und Herbst waren – es waren auch Monate der Selbstreflexion, Monate, in denen überall Klausuren abgehalten, Papiere geschrieben, Zahlen gewälzt wurden. In denen ein «Project 2029» gegründet wurde, der Titel angelehnt an das Project 2025 der Heritage Foundation, jener Denkfabrik, die das Wahlprogramm der Trump-Regierung schrieb.
Die Frage lautet, wie die Partei wieder Wahlen gewinnen kann
Minneapolis, Ende August, noch gut 70 Tage bis zum Wahltag am 4. November. In einem Konferenzhotel tagen Hunderte Delegierte des Democratic National Committee (DNC). Das DNC ist der Parteiapparat der Demokraten, der Wahlkampagnen organisiert und Spenden sammelt. Das Sommertreffen ist dieses Mal hochemotional: Es werden Gedenkreden an die Politikerin Melissa Hortman und ihren Ehemann gehalten, die im Juni in Minneapolis von einem rechtsevangelikalen Attentäter erschossen wurden. Delegierte erzählen mit Tränen in den Augen von Razzien gegen Migranten in ihrem persönlichen Umfeld. Die Parteiführung versucht, die angestaute Verzweiflung in produktive Wut umzuwandeln. «Der Wahlkampf für 2028 beginnt jetzt», sagt der DNC-Vorsitzende Ken Martin und fordert: Schluss mit dem Selbstmitleid.
Martin zieht von Ausschuss zu Ausschuss: «Sprecht mit Leuten, mit denen ihr bisher nicht gesprochen habt.» Die Parteiführung will die Demokraten dazu bewegen, sich wieder materiellen Themen zuzuwenden. Schluss mit dem Kulturkampf. Kurz vor dem DNC-Kongress veröffentlicht die liberale Denkfabrik Third Way eine Liste mit Begriffen, die Demokraten möglichst nicht mehr verwenden sollten, darunter «gebärende Person» statt «Frau», «heteronormativ» oder «triggering».
Das ist eine Provokation, gerichtet an die Parteilinke, und Teil eines Richtungsstreits, der sich bis zum blauen Dienstag zieht. Die Frage lautet, wie die Partei wieder Wahlen gewinnen kann: eher mit einem zentristischen Kurs, der auf Wachstum setzt und sich von dem absetzt, was die Republikaner Wokeismus nennen, einer Politik, die sich auf die Rechte von Minderheiten konzentriert? Oder mit ökonomischem Populismus als Partei, die weiter für marginalisierte Gruppen kämpft?
Am vergangenen Dienstag haben beide Parteiflügel gewonnen, die Zentristen in Virginia und New Jersey, die Linken in New York. Das erlaubt es den Demokraten, den Flügelstreit vorerst für beendet zu erklären. Dem Wähler, sagt Will Marshall, sei es egal, mit welcher Ideologie eine Partei antrete. Die Wähler nämlich hätten überdeutlich gemacht, was für sie das Wichtigste sei: wie teuer alles geworden ist. Ob die Wohnungen dann günstiger werden, weil neue gebaut werden oder die Mieten gedeckelt, sei den Leuten egal.
Neera Tanden, die Biden-Vertraute, sieht es ähnlich. «Wir sollten ein big tent sein», ein grosses Zelt, sagt sie – also allen Strömungen ein Dach bieten. Bezeichnenderweise haben sowohl die Zentristinnen Spanberger und Sherrill als auch Mamdani Kulturkampfthemen im Wahlkampf bewusst ausgespart. Ken Martin, Chef des Democratic National Committee, erklärt, das Rezept für Einheit und Erfolg sei gefunden: «Affordability» – das Leben wieder bezahlbar machen.
Ganz so einfach dürfte es allerdings nicht sein, die Konflikte in der Partei beiseitezuräumen. Beim Flügelstreit geht es um mehr als um inhaltliche Differenzen. Es geht auch um das grundsätzliche Verständnis von Politik: Das herkömmliche Grossspendermodell, auf dem Establishment-Demokraten ihren Wahlkampf aufbauen, kritisieren die Progressiven als korrupt. Sie setzen stattdessen auf Basisarbeit und soziale Medien.
Die Energie des Wahlkampfes von Zohran Mamdani speiste sich auch aus einem Gemeinschaftsgefühl, das die Kampagne ihren 100'000 freiwilligen Helfern stiftete. «Die Demokraten hatten vergessen, wie mächtig und wertvoll ihre Basis ist», sagt Grace Mausser, Co-Vorsitzende der Democratic Socialist Association in New York, der Bewegung, die hinter Zohran Mamdanis Erfolg steht. Das soll sich ändern. Überall im Land bringen sich Kandidaten in Stellung, die Mamdani kopieren wollen.
Im Richtungsstreit – Zentristen gegen Linke – haben die Demokraten also in den vergangenen Tagen eine Brücke gefunden. In der Frage, wie gute politische Arbeit aussieht, schon weniger. Uneins sind sie ausserdem in der Frage, wie hart die Antwort auf das unfaire Spiel der Republikaner ausfallen sollte. Wie unfair sie selbst sein müssen, um im politischen Wilden Westen der USA zu bestehen.
Auge um Auge, Zahn um Zahn
«When they go low, we go high», sagte 2016 Michelle Obama, die Ehefrau von Barack Obama. «Wenn sie sich mies verhalten, zeigen wir Anstand.» Nach diesem Prinzip reichten die Demokraten im Kongress noch im März dieses Jahres den Republikanern die Hand und halfen, einen schon damals drohenden Regierungsshutdown zu verhindern. An der Basis kam die nachgiebige Haltung allerdings immer schlechter an. Für viele sah es so aus, als würde die Parteiführung nicht richtig kämpfen.
Über die Sommermonate passten die Demokraten also vielerorts ihre Strategie an. Man könne nicht, rief DNC-Chef Ken Martin auf der Sommerklausur den Delegierten zu, «mit dem Bleistift in den Messerkampf» ziehen. Als die Republikaner in Texas im August die Wahlkreise so zuschnitten, dass die Demokraten 2026 fünf Sitze im Abgeordnetenhaus verlieren dürften, kündigte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom an, in seinem Bundesstaat ebenfalls die Wahlkreise neu zu ordnen – zugunsten der Demokraten.
Das von ihm eingebrachte Referendum gewann er am 4. November haushoch – was als Bestätigung des neuen Parteikurses gelesen wird. Und auch der wochenlange Shutdown war Ausdruck einer neuen Aggressivität, die die Basis schon lange fordert: Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Und jetzt – wo der Shutdown vorbei ist? Sieht es aus, als habe Donald Trump den Wettstreit darum, wer fieser ist (und vor allem: Wer das Fies-Sein länger aushält), doch gewonnen. Die acht Senatoren der Fraktion der Demokraten, die den Shutdown beendeten, haben geblinzelt. Sie glaubten nicht, noch irgendetwas erreichen zu können. «Sich gegen Donald Trump zu stellen, hat nicht funktioniert», sagte einer von ihnen, der parteilose Angus King, resigniert. Der innerparteiliche Friede ist damit verspielt. Die Wahlsiege aber bleiben den Demokraten. Sie können es noch.
Mit etwas gutem Willen kann man die Lage deshalb vielleicht so sehen: Wer sich streitet, ist zumindest nicht mehr depressiv.
Seufz.
Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.