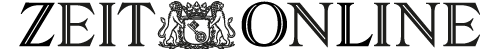Trumps nächster Anlass für Vergeltung
Ein politisches Attentat, keine Frage. Ein Angriff auf die Freiheit von Meinung und Rede – und damit auf die Demokratie selbst. Der Tod des prominenten rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk, getroffen von der Kugel eines bisher Unbekannten, ist wieder einer dieser Momente, in denen die Vereinigten Staaten sich verdunkeln. Wo zugleich spürbar wird, wie weit die Spaltung des Landes reicht. Und woran eben manche längst nicht mehr glauben: dass die Konflikte darüber, wie die Zukunft aussehen soll, sich noch im Gespräch lösen liessen.
Stattdessen werden Schuldige gesucht und benannt, die Gewalt in Worten ist allgegenwärtig im öffentlichen Diskurs, hat sich tief in den Alltag von Politik und Gesellschaft geschlichen. Es sei überfällig, dass sich die Menschen in den USA der Tatsache stellten, «dass Gewalt und Mord die tragische Folge davon sind, wenn man diejenigen, mit denen man nicht einer Meinung ist, (…) verteufelt», hielt Donald Trump in einer Videoansprache aus dem Oval Office am Abend nach der Tat fest. Wie hohl das klingt nach all dem Hass und all der Hetze, die seine eigenen politischen Auftritte seit jeher kennzeichnen. Die Gefahr, dass aus Worten tödliche Taten werden, hat ihn immer nur in einer Hinsicht bewegt.
Denn wen meint der Präsident, wenn er sofort wieder dazu übergeht, die «radikalen Linken» zu verteufeln, deren Rhetorik direkt verantwortlich sei «für den Terrorismus, den wir heute in unserem Land erleben»? Da gab es von einem Täter noch keine Spur, über das Motiv war noch nichts bekannt. Und Trump wandte sich wieder einmal nur an den Teil der Bürgerinnen und Bürger, den er als seine Bewegung begreift. Das war schon nach den versuchten Attentaten auf ihn selbst so: für ihn Gelegenheiten, die eigene Erzählung als Opfer zu stärken, als tapferer Kämpfer gegen einen rücksichtslosen Feind. Es sind immer die anderen. Trump, der Märtyrer. Und jetzt eben: Kirk, der Märtyrer. Die vielen Angriffe, Anschläge, Attentate auch auf demokratische Politiker lässt der Präsident unerwähnt.
«Meine Regierung wird alle finden»
«Wir stehen möglicherweise vor einer Ära extremer Gewalt in der amerikanischen Politik», warnte der Politikwissenschaftler Robert A. Pape Mitte Juni in der New York Times. Er forscht seit Jahrzehnten zu politischer Gewalt und verfolgt seit dem von Trump mindestens inspirierten Sturm auf das Kapitol in Washington, D. C. am 6. Januar 2021 die Einstellungen der 270 Millionen US-Amerikanerinnen und -Amerikaner dazu. Und Pape beobachtet in diesen Tagen: Die Gewalt kommt von beiden Seiten des politischen Spektrums – so wie auch das öffentliche Einvernehmen, dass sie nötig sein könne, also ihre Duldung und Beförderung auf beiden Seiten zunehmen, links wie rechts. Die zentrale Erkenntnis seiner und anderer Forschung ist: Je mehr Unterstützung politische Gewalt in der Öffentlichkeit erfährt, desto häufiger wird sie in Taten umgesetzt. Waffen gibt es in den USA ja für alle genug.
Trump könnte seinen Teil dazu beitragen, diese Spirale zu bremsen. Könnte sich als Präsident über den klaffenden Spalt in der Gesellschaft stellen, wenigstens für den Moment. Er tut es nicht, weil er glauben muss, dass insbesondere die Radikalisierung seiner Anhängerinnen und Anhänger ihm nützt. Weil er politisch davon profitiert, wenn die Gesellschaft kaum noch in der Lage ist, zusammenzurücken, zu debattieren, Kompromisse zu ertragen. Der Sieg über den Feind wird so wichtiger als die Suche nach dem richtigen Weg. Und die Momente des Innehaltens, wenn die Wut in Gewalt umschlägt, werden immer kürzer, wenn es sie überhaupt noch gibt.
Charlie Kirk mag rassistische Einstellungen vertreten und für einen christlichen Nationalismus gekämpft haben, der am Ende auch nicht mehr viel mit Demokratie und gleichen Rechten für alle zu tun gehabt hätte – ganz nach Trumps Geschmack. Aber er wollte immerhin noch reden mit denen, die anders denken. Der Präsident dagegen wird sich bestätigt sehen in seinem autoritären Weg von Rache und Bestrafung, der seine zweite Amtszeit in Teilen prägt: gegen seine Gegner in Staat und Gesellschaft, gegen liberale Institutionen und Errungenschaften, gegen jeden Widerstand.
Im Frühjahr 2023 hatte Trump bei der grossen politischen Konferenz des konservativen Amerikas, CPAC, versprochen: «Ich bin euer Krieger, ich bin euer Richter. Und für diejenigen, denen Unrecht getan wurde und die betrogen wurden: Ich bin eure Vergeltung.» Nach Kirks Tod kündigte er an: «Meine Regierung wird alle finden, die zu dieser Gräueltat und jeder anderen Form von politischer Gewalt beigetragen haben, auch die Organisationen, die diese finanzieren und unterstützen.» Nach Versöhnung klingt das nicht, eher nach Eskalation. Es ist ein dunkler Moment, und vielleicht wird es so schnell auch nicht mehr hell.
Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.