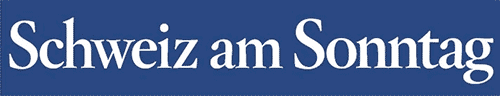So viele Kinder werden von der KESB ins Heim geschickt – erstmals liegen Zahlen vor
Seit ihrer Einführung vor dreieinhalb Jahren steht sie unter Dauerbeschuss. Kaum eine andere Behörde in der Schweiz wird so stark kritisiert wie die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). Ihr Tätigkeitsgebiet – der Eingriff des Staates in die intimsten Bereiche des Familienlebens – führt zu emotionalen Debatten. Ob die KESB tatsächlich besser ist als ihre Vorgängerin, die Vormundschaftsbehörde, wird von den Kritikern angezweifelt.
Erstmals zeigen nun Zahlen, wie sich die KESB seit ihrer Einführung am 1. Januar 2013 entwickelt hat. Sie stammen aus der aktuellen Statistik der Kokes, der Dachorganisation der KESB, und liegen der «Schweiz am Sonntag» vor. Für die Erhebung wurden Daten von allen 146 KESB in der Schweiz zusammengetragen. Nachdem die Zahlen in den Vorjahren noch unvollständig und gesamtschweizerisch nicht vergleichbar waren, ist es nun möglich, erste Trends aufzuzeigen.
Anders als von den KESB-Gegnern befürchtet, ergreift die neue Behörde leicht weniger oft sogenannte «Schutzmassnahmen» als die Vormundschaftsbehörde. Bei den Kindern haben die Schutzmassnahmen von 1996 bis 2012 jährlich um vier Prozent zugenommen. Seit der Einführung der KESB ist erstmals ein Rückgang um 1,3 Prozent zu verzeichnen. Per Ende letztes Jahr gab es in der Schweiz 40'600 Kinder mit einer Schutzmassnahme. Bei Erwachsenen wie auch bei Kindern betrifft der grösste Teil der KESB-Massnahmen die Anordnung eines Beistands. Bei beiden Gruppen macht dies rund 70 Prozent aller Fälle aus.
und Erwachsenenschutzbehörde
(KESB) ihre Vorgängerin,
die Vormundschaftsbehörde, ab.
Das entsprechende Gesetz wurde
vom damaligen Justizminister
Christoph Blocher (SVP) ins Parlament
eingebracht. Die 1415 kommunalen
Vormundschaftsbehörden
wurden durch 146 KESB ersetzt.
Während vorher Gemeinderäte
über die Dossiers aus dem
Kinder- und Erwachsenenschutz
berieten, sollte das System professionalisiert
werden. Neu bestand
die Behörde aus einem Team von
Juristen, Psychologen und Sozialarbeitern.
Ebenfalls ein wesentlicher
Punkt bei der Revision war,
dass Beschwerden an ein unabhängiges
Gericht gelangten und
nicht mehr wie früher auf dem
Pult des Gemeinderates landeten.
Zu Beginn war die Neuerung weitgehend
unbestritten. Später lösten
umstrittene Einzelfälle landesweite
Empörung aus.
Weniger Fremdplatzierungen
Was aufgrund der vergangenen Ereignisse besonders interessiert, ist, wie oft die KESB ein Kind fremdplatziert. Der Statistik ist zu entnehmen, dass per Ende des letzten Jahres 3449 Kinder fremdplatziert waren, also in einem Heim, bei einer Pflegefamilie oder bei einem Verwandten lebten. Das ist eine hohe Zahl. Jedoch ist sie tiefer als in der Zeit, als noch die Vormundschaftsbehörde über das Kinderwohl entschied. Ende 2012 waren 3853 Kinder fremdplatziert. Diese Zahl ist seit 2007 leicht gewachsen. Unter der Führung der KESB verzeichnet sie einen Rückgang (siehe Grafik). Für 2012 und 2013 liegen keine Zahlen vor.
Im Kanton Basel-Stadt zeigt sich deutlich, dass heute weniger Kinder ihren Eltern entzogen werden als früher. 2012 wurden 45 Kinder fremdplatziert, 2013 waren es 30, 2014 noch 25 und letztes Jahr 24.
Christoph Häfeli, Kinderschutzexperte, Jurist und KESB-Berater, sagt: «Die Zahlen zeigen, dass das Zerrbild von SVP-Nationalrat Pirmin Schwander und seinesgleichen nichts mit der Realität zu tun hat.» Bereits nach den ersten zwei Jahren mit der neuen KESB habe er gesagt, dass das System besser sei. Jetzt sei er davon umso mehr überzeugt.
Die St.Galler SVP-Nationalrätin Barbara Keller-Inhelder gehört zum Lager der KESB-Kritiker. Als Mitinitiantin der Volksinitiative «Mehr Schutz für Familien» will sie das Recht der Angehörigen gegenüber der KESB stärken. Die Unterschriftensammlung für die Initiative beginnt in diesen Tagen. Konfrontiert mit den aktuellen Zahlen, zeigt sie sich skeptisch.
«Uns KESB-Kritikern wird jeweils die Auskunft verweigert, wenn wir uns für spezifische Fallzahlen interessieren.» Sie räumt jedoch ein: «Sollte sich herausstellen, dass die KESB tatsächlich weniger Massnahmen verfügt als die Vormundschaftsbehörden, würde mich das freuen.» Auch eine Reduktion der fremdplatzierten Kinder würde Keller-Inhelder begrüssen: «Mein persönlicher Eindruck ist aber ein anderer.» Ein allfälliger Rückgang bei den Gesamtzahlen dürfe nicht dazu führen, bei Einzelfällen wegzusehen.
Beschwerden meist abgelehnt
Eine Auflistung, wie oft die KESB Fehlentscheide trifft, gibt es nicht. Auf Nachfrage der «Schweiz am Sonntag» präsentieren aber verschiedene Kantone ihre Beschwerde-Statistik (siehe Tabelle). Patrick Fassbind, KESB-Leiter in Basel-Stadt, sagt, dass jährlich nur gegen ein Prozent der Entscheide Beschwerde geführt werde und diese wiederum meistens abgewiesen würden. Ähnlich tönt es beim Kanton Graubünden. Elisabeth von Salis sitzt in der Aufsichtsbehörde der dortigen KESB. «Deutlich weniger als ein Prozent aller Entscheide unserer fünf Bündner KESB werden angefochten. Und davon werden grundsätzlich rund zehn Prozent gutgeheissen», sagt sie. Beschwerden gegen Fremdplatzierungen wurden im vergangenen Jahr allesamt vor Gericht abgewiesen.
Die hohe Erfolgsquote der KESB vor Gericht ist für SVP-Nationalrätin Keller-Inhelder nur beschränkt aussagekräftig. Merke eine KESB, dass sie in einem Beschwerdeverfahren unterliegen könnte, würden Massnahmen oft abgebrochen. Zusätzlich werde der Zugang zu den Rekursinstanzen unnötigerweise erschwert. «Viele Betroffene sind einfache Leute, die keine Erfahrung mit unserem Rechtssystem haben.» Legten sie eine Beschwerde ein, sei die erste Reaktion der Justizbehörden in manchen Fällen ein Brief, mit dem auf die geringen Erfolgsaussichten und die im Misserfolgsfall anfallenden Kosten hingewiesen werde: «Das schreckt viele ab.»
Und doch: Die Abschaffung der Vormundschaftsbehörden habe Verbesserungen gebracht, findet auch Keller-Inhelder. Die grosse Mehrheit der KESB-Mitarbeiter leiste gute Arbeit: «Die angestrebte Professionalisierung wirkt sich vielerorts positiv aus.» Das Problem seien die aktuellen gesetzlichen Grundlagen. Sie liessen zu, «dass nicht kompetente Mitarbeiter hanebüchene Eingriffe in die verfassungsrechtlich geschützten Freiheitsrechte vornehmen können».
KESB-Berater Häfeli sagt: «Mir ist kein Fall bekannt, bei dem die KESB bei der Fremdplatzierung schwerwiegende Fehler gemacht hat.» Er mache die Erfahrung, dass die Behörden in diesem Bereich sehr zurückhaltend seien. Ein grosser Vorteil sei, dass die Kinder von der KESB angehört würden. «Früher wurde mit Entscheiden über sie verfügt.» In den Anfängen der KESB seien bestimmt Fehler passiert, räumt Häfeli ein. Und dass sich die Behördenmitglieder teilweise hinter Stillschweigen verschanzen würden, statt offensiver zu kommunizieren, habe viel Raum für Spekulationen gelassen. Doch alles in allem ist Häfeli überzeugt, dass Juristen, Psychologen und Sozialarbeiter kompetenter über ein Kinds- und Erwachsenenwohl urteilen können als ein Gemeinderat.