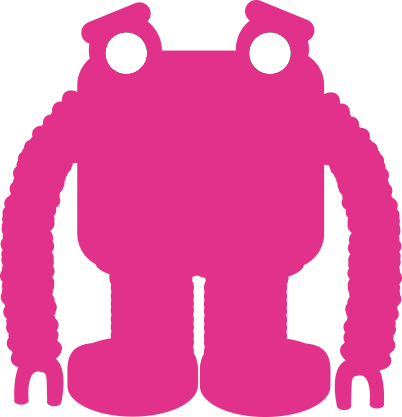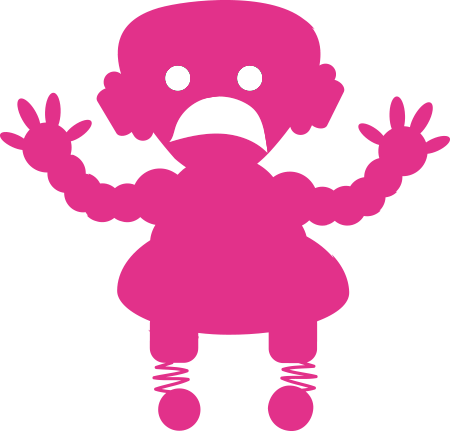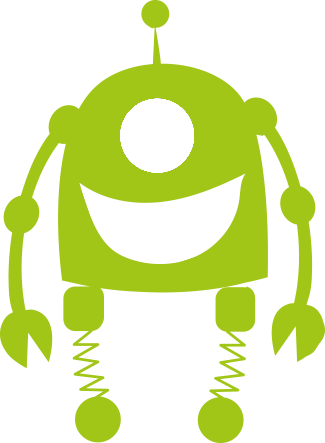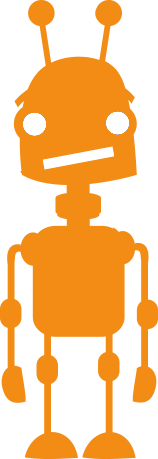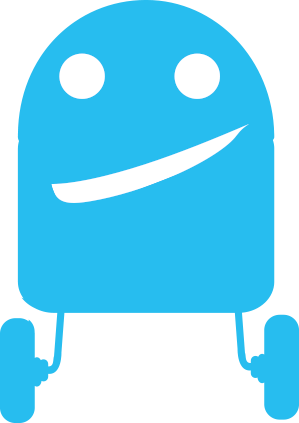So gross ist das Risiko, dass du wegen einem Roboter schon bald deinen Job los bist
Zum ersten Mal befasst sich nicht die Science-Fiction mit dem Szenario, in dem Roboter den Menschen die Arbeit abnehmen, und zwar mehr als ihnen lieb ist. Für die Wissenschaft ist das Szenario Realität, die Wirtschaft versucht, sich darauf einzustellen, während die Politik die hässlichen Seiten der schönen neuen Welt erkannt zu haben glaubt.
Das Phänomen ist nicht nur – auch technisch – komplex, es ist nicht einmal auszumachen, wo und wann es genau seinen Ursprung hatte und noch weniger, in welche Zukunft es weist. Wir wissen nur, dass diese Zukunft schon begonnen hat, irgendwann in den letzten Jahren.
Schleichend exponentiell
2012 trat die drei Jahre davor gegründete Fahrdienst-Plattform Uber aufs Gaspedal, zunächst ganz sacht: jeden Monat 1 bis 2 Teilnehmer mehr in den USA. Heute sind es fast 50. Noch immer nicht astronomisch viel, möchte man sagen. Aber die Zunahme ist exponentiell. Astronomisch ist also das Potenzial.
Potenzial – eine Dauerbegleiterscheinung der Digitalisierung und ihrer bisherigen Wunder: Die Tech-Branche ist seit den späten 1990er-Jahren dafür bekannt, dass ihre Unternehmen milliardenschwere Börsenwerte erreichen, ohne überhaupt Gewinne vorweisen zu können. Die Aktien finden dennoch Käufer, aus Glauben an die Zukunft, an das Potenzial.
Selbst die Finanzindustrie erhält Konkurrenz: Banken befürchten, dass sie wegen Zahlungssystemen von Apple, Google und Facebook obsolet werden. Und in der Maschinen-Industrie sorgt der Roboter für Endzeitstimmung: Der Arbeiter, der nie schläft, nie krank ist und immer mehr kann. Die künstliche Intelligenz wächst, die natürlichen Distanzen schrumpfen.
Disruptiv oder nicht, ist die Frage
Es kann sich niemand an einen Startschuss für diesen Auf- und Umbruch erinnern. Aber die Digitalisierung scheint seit Beginn dieses Jahrzehnts eine neue Stufe der Durchwirkung ihrer Umwelt erreicht zu haben. 2011 wurde diesem Prozess mit dem Begriff der Industrie 4.0 der Status einer vierten industriellen Revolution zugeschrieben. Gerade in der Digitalisierung ist mit epochalem Pathos indes sparsam umzugehen: Die Kommerzialisierung des Internets begann Anfang der 1990er-Jahre, die Technologie gab es aber schon seit über einem Jahrzehnt. Die Homepage als Visitenkarte und bald als Vertriebskanal folgte auf dem Fusse. Doch schon um die Jahrtausendwende erlitt diese «New Economy» im Platzen der Dot-Com-Blase eine Zwischen-Bruchlandung: Es hatte nicht gereicht, eine Homepage zu haben, um die Gesetze von Schwerkraft und Buchhaltung ausser Kraft zu setzen. Um auf das Potenzial zurückzukommen: Es war überschätzt worden.
Was also ist jetzt anders? Der Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn prägte in den 1960er-Jahren den Begriff des Paradigmenwechsels. Sind wir Zeit-Zeugen einer solchen Revolution – oder nur einer Transformation? Oder mit dem fast viral gewordenen Begriff unserer Tage gefragt: Ist Industrie 4.0 disruptiv?
Die fünf Teile der Serie
- Dienstag: Die digitale Revolution und ihre Folgen.
- Mittwoch: Wo und wie wir in Zukunft arbeiten werden.
- Donnerstag: Wie sich der Standort Schweiz entwickelt.
- Freitag: Welche neuen Jobprofile entstehen.
- Samstag: Was der Ökonom Thomas Straubhaar dazu sagt.
Skeptiker wie der US-Ökonom Robert Gordon führen das seit längerem messbare Erlahmen des Produktivitätswachstums in entwickelten Ländern darauf zurück, dass der Beitrag der Digitalisierung nach 1995 überschätzt wird. Er sei nicht zu vergleichen mit den Innovations-Schüben, die Dampfmaschine oder Elektrizität ausgelöst hatten.
Etwas Grosses ist im Netz
Was aber, wenn wir nur falsch messen? Der Fortschritt liegt vielleicht nicht so sehr im Ausstoss der Produktion, sondern darin, dass die Herstellung immer weniger kostet, immer weniger Zeit braucht – immer weniger Arbeit. 1995 verursachte das Speichern einer Datenmenge von 1 Gigabyte Kosten von um die 10 000 Dollar. Heute sind es 3 Cent. Ist das nicht disruptiv?
Es ist ein Merkmal des aktuellen Wandels, dass man ihn nicht kommen sah, obwohl die nötige Technologie da war. Seine Umrisse zeichnen sich erst allmählich ab – wie früher in den Krimis, wenn das Antlitz des Mörders bei der Entwicklung einer Fotografie langsam Gestalt annahm. Oder so, als schaute ein Biologe auf das Meer, in der Erwartung, dass eine bisher unbekannte Wal-Art auftaucht.
Und daran scheint kein Zweifel mehr zu bestehen: Etwas Grosses verdichtet sich da draussen, im Ozean der digitalen Verflüssigung – im Internet der Dinge.
Die Angst vor dem Showdown
Um es mit den Worten von Donald Rumsfeld zu sagen: Industrie 4.0 ist eine bekannte Unbekannte, eine «Known Unknown»: Man weiss, dass man etwas nicht weiss, aber nicht genau, was. Damit geht so etwas wie die Angst vor dem Showdown um, vor dem Moment, wenn sich der Feind zu erkennen gibt, und davor, dass es dann bereits zu spät ist. Die Branchen versuchen, auf die amorphe Bedrohung zu reagieren. Aber das ist schwierig, wenn man nicht weiss, worauf.
Finanzdienstleister haben Kreativ-Labors mit dem Namen «Inkubatoren» eingerichtet, in die sie Mitarbeiter mit Fintech-Ideen schicken, um diese ganz auszubrüten – losgelöst von den täglichen Denkmustern. Man kann nicht anders als sich vorzustellen, wie sie sich von ihren Familien verabschieden und dann von einer schwarzen Limousine abgeholt werden, während die Daheimgebliebenen die Augen verdrehen: Schon wieder drei Tage Inkubator. Es sieht nicht nach Panik aus, aber nach viel Ratlosigkeit.
Arbeit nervt?
Der Gesetzgeber ist versucht, die Reissleine zu ziehen. Denn die neue «Arbeit», bei der niemand angestellt ist, bedroht auch die Sozialwerke. Und von wegautomatisierten Jobs werden diese noch weniger gespeist. Vor wenigen Wochen hat etwa die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) entschieden, dass Uber-Fahrer Angestellte sind. Aber der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten, höchstens bremsen, und meist nicht lange. Was möglich ist, geschieht irgendwann.
Es braucht eine Grundsatzdebatte – und vielleicht grundsätzliche Änderungen. Eine radikale Lösung ist das nicht nur von linken Kreisen portierte staatliche Grundeinkommen. In einer Welt mit immer weniger Arbeit, so der Gedanke, macht ein Recht auf Arbeit kaum mehr Sinn. Wenn schon, eines auf Nichtarbeiten, um kreatives Potenzial freizusetzen für jene Arbeit, die Maschinen – hoffentlich – noch lange nicht können. Schon in den 1970er-Jahren gab es Experimente in Kanada und in den USA. Nun startet Finnland einen zweijährigen Test, die Schweiz stimmt am 5. Juni gar über die Einführung ab: 2500 Franken pro Monat, bedingungslos.
Ist das die Verheissung: Eine Welt, in der es die Selbstdeklaration als Kreative erlaubt, niedere Arbeit Immigranten oder Drittweltländern zu überlassen? «Geh du da mal lieber hin für mich», heisst es im Song «Arbeit nervt» der Hamburger Elektro-Punk-Gruppe Deichkind – das Horrorszenario salonfähiger Arbeitsmoral. Aber wenn sich die Linke nach über 100 Jahren vom Recht auf Arbeit verabschiedet, sollten auch andere Parteien einige Dogmen dem freien Denken opfern. Sonst bleibt nur eines: der Inkubator für Politiker.
Das Grundeinkommen darf nicht ungeprüft als unrealisierbar zu den Akten gelegt werden. Es ist gewiss nicht alternativlos, die Grundsatzdiskussion, die es erzwingt, ist es sehr wohl. (aargauerzeitung.ch)