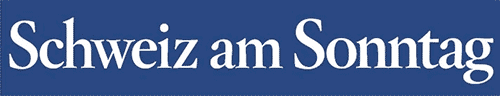Vom Gamer zum Copter-Piloten: Was diese Jungs in der Luft treiben, ist ziemlich krass
Mit einem schrillen Ton hebt die Drohne ab. Wie ein wildgewordenes Insekt saust sie durch die Luft, macht Loopings, fliegt durch ein Tor, dreht ab und steigt senkrecht in die Höhe, um dann steil herunterzustechen. Ein zweites Flugobjekt folgt ihr, schliesst zu ihr auf, bis beide gleichauf sind. Bei der nächsten Linkskurve knallen die Drohnen ineinander. Sie überschlagen sich und schmettern auf den Boden.
Die beiden Piloten schieben sich ihre Videobrillen in die Stirn, grinsen sich an und machen sich auf zur Absturzstelle, um den Schaden zu begutachten.
«Drohne» ist verpönt
Sascha Müller und Timothy Trowbridge heissen die beiden Piloten. Sie trainieren an diesem Septemberabend mit ein paar Kollegen zusammen auf einem stillgelegten Güterbahnhof für die Europameisterschaft im Drohnenfliegen, die nächste Woche in Ibiza stattfindet.
Wobei das Wort «Drohne» in der Szene verpönt ist – heissen doch auch die unbemannten Kampfflieger Drohnen. Hier spricht man von «Race Copters» oder aufgrund der vier Propeller auch von «Quadrocopters». Sie sehen ein bisschen aus wie übergrosse Insekten und klingen auch so. Bloss wenige hundert Gramm schwer sind sie, schaffen aber Spitzengeschwindigkeiten von über 120 Stundenkilometern – und beschleunigen von 0 auf 50 schneller als ein Formel-1-Wagen.
Der Pilot steht am Boden und befindet sich doch irgendwie in der Drohne. Denn auf seiner Videobrille sieht er live, was die Kamera auf seinem Flugobjekt aufzeichnet. First Person View Racing, kurz FPV Racing, also Rennen aus der Ego-Perspektive, nennt man das. «Es ist, als fliege man selber. Ein riesiger Adrenalinschub. Dennoch begibt man sich nie in Gefahr», sagt Drohnenpilot Sascha Müller. Abstürze enden zwar häufig mit Materialschäden, aber nie mit Verletzungen.
Drohnenfliegen als Sport beginnt sich gerade zu etablieren. In den USA veranstaltet die Drone Racing League Rennen durch ein Football Stadium, und in Dubai fand dieses Jahr ein Race statt, bei dem eine Million Dollar an Preisgeld ausgeschüttet wurde – gewonnen hat der 15-jährige Engländer Luke Bannister. Seither ist er ein Star.
Ähnlich wie das Kollektiv, das sich Rotor Riot nennt. Die vier Piloten tingeln durch die Welt und fliegen an den ungewöhnlichsten Orten – etwa durch die Geisterstadt Tschernobyl. Mittlerweile leben sie dank ihrer YouTube-Filme und Sponsoren von ihrem Hobby. Sascha Müller wird an der Europameisterschaft in Ibiza zusammen mit Rotor Riot eine Flugshow fliegen. Eine grosse Ehre für den 33-jährigen Schweizer.
Modellbau-Freaks und Gamer
Zum Drohnenfliegen ist Müller über den Modellbau gekommen. Wie fast alle Piloten baut er seine Copters selber zusammen. Er sucht die besten Komponenten – wie Steuerung, Motor, Rotoren – aus, lötet sie auf den Rahmen und justiert die Technik, bis die Drohne optimal durch die Luft fliegt. Rund 500 Franken kostet ein solches Flugobjekt. Und selbstverständlich haben die Wettkämpfer mehrere davon.
Ob für den Wettkampferfolg die Ingenieurs-Kunst oder das Fluggeschick wichtiger ist, darüber gehen in der Szene die Meinungen auseinander. Timothy Trowbridge ist überzeugt, dass die «Skills an den Sticks», die Fähigkeit, mit den Steuerhebeln umzugehen, zentral sind. «Man braucht eine gute Hand-Augen-Koordination, schnelle Reflexe und muss mit der Nervosität umgehen können», hält der 24-jährige Informatiker fest.
All diese Fähigkeiten hat er sich beim Videogames-Spielen angeeignet. Denn bevor er letzten Dezember mit dem Copter-Fliegen begonnen hat, war Trowbridge ein begeisterter Gamer. Neben den ehemaligen Modellbau-Freaks machen die Game-Nerds den zweiten grossen Teil der Race-Piloten aus.
Überhaupt hat der Drohnenrennsport einiges mit dem E-Sport, dem professionellen Computerspielen, gemeinsam. Mit Sport im Sinn von Körperlichkeit haben beide nichts zu tun; doch hier wie dort geht es darum, durch Geschick im Wettkampf besser zu sein als die anderen. Verbreitung findet beides über Videos im Internet.
Das Aufnehmen der spektakulären Flüge stellt kein Problem dar, da ja ohnehin eine Kamera auf den Copter montiert ist, die dem Piloten das Bild auf die Videobrille projiziert. Während die Flugobjekte durch die reale Welt schwirren, befindet sich der Pilot wie in einem Game in einer abgeschotteten virtuellen Realität. Beim First Person View Racing vermischen sich Realität und Virtualität. Damit scheint es die perfekte Sportart für das 21. Jahrhundert zu sein, für die Zeitepoche also, in der das Digitale das Analoge immer mehr überlagert.
Erste Schweizer Meisterschaft
Wo der E-Sport vor zehn Jahren war, da ist First Person View Racing heute. Die ersten medial wirksamen Gross-Events sind da, die ersten Stars sind geboren – und die Szene beginnt sich zu professionalisieren. Auch in der Schweiz. Zuerst haben sich die Piloten bloss in einer Facebook-Gruppe organisiert, ehe dieses Jahr der Verein FPV Racer Schweiz gegründet wurde. «Vorerst geht es darum, feste Trainingsplätze zu installieren und Rennen zu organisieren», sagt Sandro Geissmann, der den Verein mitgegründet hat.
So wurde im Sommer in Payerne zum ersten Mal die Schweizer Meisterschaft ausgetragen. Und nächstes Wochenende finden an der Spielzeugmesse Suisse Toy in Bern die Swiss Indoor Masters statt. Der Veranstaltungsort ist gut gewählt. «Hier können wir unseren Sport einem breiten Publikum vorstellen», sagt Geissmann. Das soll auch dazu dienen, negative Vorurteile in der Gesellschaft abzubauen.
Denn wie vor zehn Jahren die Computerspiele – man erinnert sich an die «Killerspiele»-Debatte – sind Drohnen heute oft verpönt. Viele haben Angst, dass sie ausspioniert werden oder plötzlich ein unkontrolliertes Flugobjekt auf sie fällt. Deshalb legt der Verein grossen Wert darauf, dass die Piloten nur auf abgelegenen Plätzen fliegen, wo sie niemanden stören. Und umso mehr nervt sich Geissmann, wenn so etwas passiert wie diesen Sommer, als ein Pilot mit einer Drohne über den Kühlturm des Kernkraftwerks Leibstadt flog und das Video ins Netz stellte. «Keiner von uns würde eine solche Dummheit machen», versichert er.
Einmal Superman sein
Extreme Flüge unternimmt auch Raphael Pirker immer wieder. Der Schweizer ist ein Drohnen-Pionier. Vor vier Jahren schon hat er mit seinen Freunden als Kollektiv Team Black Sheep begonnen, mit Drohnen durch die Metropolen dieser Welt zu fliegen und eindrückliche Videos aufzunehmen. Die Piloten flogen um den Big Ben in London, durch die Zacken der Freiheitsstatue in New York oder über die Golden Gate Bridge in San Francisco. Millionenfach wurden die Videos angeschaut.
Doch ist das nicht gefährlich? Nicht, wenn man wisse, was man tue, sagt Pirker. «Jeder Flug wird bis ins kleinste Detail vorbereitet, das Equipment wird in mehreren langen Testflügen allen möglichen Strapazen unterzogen», versichert der Pilot. Die Sicherheit des Luftraums und der Personen am Boden sei oberstes Gebot.
Ihn reizt das bisher Unverwirklichte. «Ich sehe ein monumentales Gebäude und stelle mir vor, wie sich Superman oder Spiderman da runterstürzt. Das will ich mit der Drohne nachstellen», schwärmt der Schweizer. Diving, Tauchen also, nennt man das auch, wenn man an einem Gebäude senkrecht im Sturzflug herunterfliegt. Es sind die spektakulärsten Szenen der Videos.
Wenn es tatsächlich einmal gelingen soll, das ganze Hirn zu digitalisieren und so unsterblich zu werden, wie Freaks aus dem Silicon Valley behaupten, dann möchte man eines: als Drohne digital wiedergeboren werden.