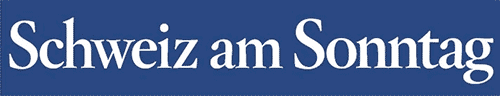Wie wichtig sind die Bilateralen I für die Schweiz? Nicht so wichtig – glaubt man dieser Studie
Das Vertragspaket der Bilateralen sei nicht derart existenziell für die Schweizer Wirtschaft, wie immer behauptet werde. Weder wenn man die sieben Verträge einzeln analysiere noch als Paket. Zu diesem Schluss kommt Ökonom und «Weltwoche»-Journalist Florian Schwab im Gutachten «Was hat der Bürger von den Bilateralen?» Eher «im Gegenteil», folgert er: «Der wirtschaftliche Gehalt der Bilateralen I erweist sich als erstaunlich dünn.» Schwab hat das Gutachten für Tito Tettamanti verfasst. Mit dem Auftrag, Berechnungen von Kosten- und Nutzenaspekten vorzulegen. Die Kosten seien in kaum einer Untersuchung ausführlich gewürdigt worden. «Eine Lücke, die das vorliegende Gutachten teilweise zu schliessen versucht.»
Schwab hat dafür die wichtigsten Studien zu den Bilateralen ausgewertet:
- die Untersuchungen der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich (2008, 2012 und 2015),
- die Gutachten der Beratungsbüros BAK Basel Economics AG und Ecoplan, die 2015 ein Gutachten im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) vorlegten,
- das Avenir-Suisse-Buch («Bilateralismus. Was sonst?»).
Die Effekte, die er zu den Bilateralen I fand, seien «widersprüchlich und betragsmässig nicht besonders spektakulär», schreibt Schwab. «Ein wissenschaftlicher Konsens über positive, statistisch signifikante Effekte besteht nicht.» Nach Berechnungen Schwabs liegt der jährliche Nutzen pro Kopf der sieben bilateralen Abkommen minimal bei minus 1050 und maximal bei plus 2073 Franken. «Im arithmetischen Mittel ergäbe das einen positiven jährlichen Nutzen des Pakets von rund 500 Franken», schreibt Schwab. Absolut betrachtet, liege dieser Mittelwert bei 2,84 Milliarden Franken pro Jahr.
Entscheidend ist für ihn vor allem, wie man die Personenfreizügigkeit und das Abkommen über den Luftverkehr wertet. Hier liegen Welten zwischen minimalem und maximalem Wert. Die Einschätzung der Personenfreizügigkeit etwa schwanke sehr stark. Sie hänge davon ab, ob man die Wachstumsschwäche der Schweiz in den 1990er-Jahren als hausgemacht taxiere. Oder ob man sie als Ausdruck der Sinnkrise in der Beziehung mit der EU nach dem EWR-Nein von 1992 sehe. Je nach Sichtweise habe die Personenfreizügigkeit einen jährlichen Verlust von 8,4 Milliarden zur Folge – oder einen Gewinn von 5,3 Milliarden.
Auch beim Luftverkehrs-Abkommen ist die Spannweite zwischen minimalem (400 Millionen pro Jahr) und maximalem Wert (9 Milliarden pro Jahr) sehr breit. Das Beratungsbüro BAK Basel zeichnet ein düsteres Bild. 250 Flugverbindungen würden ab dem Jahr wegfallen, in dem die Bilateralen gekündigt würden. Das könne in den ersten Jahren bis zu 9 Milliarden kosten. Schwab taxiert dieses Szenario als «unnötig düster». Ecoplan hingegen prognostiziert einen Rückgang der Direktverbindungen aus der Schweiz heraus von 20 Prozent – und Kosten in der Höhe von 400 Millionen. Gesamthaft betrachtet, liegt der minimale Wert der Bilateralen I mit den sieben Abkommen pro Jahr bei minus 8,1 Milliarden Franken, der maximale Wert bei plus 16,6 Milliarden.
Schwabs grösste Kritik an den Studien liegt aber darin, dass sie keine Kostenrechnungen machten. Schwab nennt mehrere Kostenfaktoren, die mit den Bilateralen verbunden sind. So erkaufe sich die Schweiz den Marktzugang in der EU mit der Übernahme oft teurer Regulierungen, obwohl Erleichterungen beim grenzüberschreitenden Verkehr durch den Wegfall nichttarifärer Handelshemmnisse einseitig der EU zugutekämen.
Auch hätten die flankierenden Massnahmen zu einer fast flächendeckenden Einführung eines Mindestlohns für einfachere Tätigkeiten geführt. «Dazu hat sich eine 200 Millionen teure Kontrollbürokratie entwickelt», schreibt Schwab. Auch die zunehmende Einwanderung in den Sozialstaat verursache hohe Kosten. Die neuste Sozialhilfestatistik für 2014 zeige, dass die Zahl der Sozialhilfebezüger aus der EU zwischen 2009 und 2014 um 40 Prozent zugenommen habe – ein Kostenwachstum von 165 Millionen.
«Es war höchste Zeit für eine Analyse wie diese», sagt Wirtschaftsprofessor Reiner Eichenberger. Über die Bedeutung der Bilateralen I herrsche «grösste Unklarheit», obwohl die Schweiz demnächst entscheiden müsse, wie sie die Zuwanderung steuern wolle. «Eine kritische Gesamtsicht fehlte bisher.» Eichenberger konnte die Studie in einem früheren Stadium lesen und Ratschläge geben. «Natürlich ist nicht alles ‹perfekt›», sagt er. «Aber die Studie ist wirklich wertvoll und ein wichtiger Beitrag für die Diskussion.» Die Bilateralen I gingen als Paket zwar in die richtige Richtung, seien aber «relativ unbedeutend», sagt er. «Natürlich ist es schön, existieren sie weiter. Sollte das aber nicht mehr der Fall sein, wäre das keine Katastrophe.»